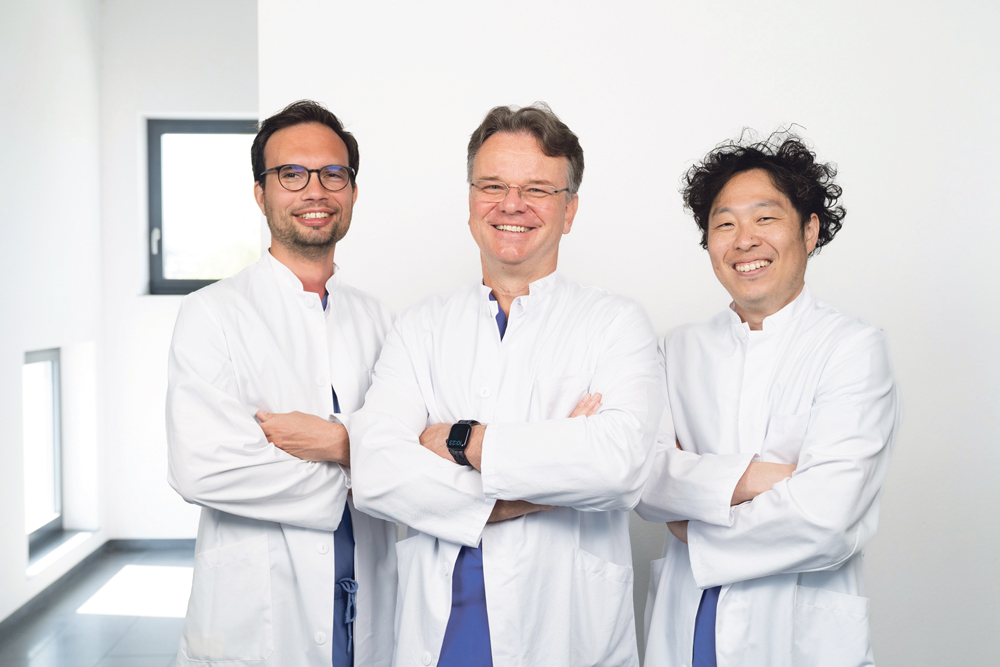Kanu der Klischees: Warum „Das Kanu des Manitu“ mehr über Deutschland erzählt als über indigene Kulturen
Mehr als fünf Millionen Menschen haben ihn gesehen, im gesamten deutschsprachigen Raum sogar über sechs Millionen: „Das Kanu des

Mehr als fünf Millionen Menschen haben ihn gesehen, im gesamten deutschsprachigen Raum sogar über sechs Millionen: „Das Kanu des Manitu“ ist der erfolgreichste Kinofilm des Jahres. Ein Vierteljahrhundert nach „Der Schuh des Manitu“ zeigt sich, wie tief die Westernparodie von Michael „Bully“ Herbig im deutschen Popgedächtnis verankert ist. Während internationale Blockbuster kommen und gehen, reicht hier offenbar ein Kanu, ein paar Perücken und vertraute Gags, um Kinosäle zu füllen. Der Jubel ist groß, die Nostalgie noch größer und die Frage drängt sich auf, warum gerade dieses Bild vom „Wilden Westen“ bis heute so zuverlässig funktioniert.
Denn der erneute Erfolg ist mehr als nur eine Kinomeldung. Er erzählt von einer kulturellen Kontinuität, die weit über Humor hinausgeht. Während Debatten über kulturelle Aneignung, koloniale Gewalt und Repräsentation indigener Perspektiven in den letzten Jahren deutlich an Schärfe gewonnen haben, feiert eine Filmreihe Rekorde, deren Bildwelten aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Tipis, Blutsbrüderschaften, edle Häuptlinge und tölpelhafte Cowboys, das Inventar ist vertraut, fast beruhigend.
Mit flatternden Perücken, staubiger Prärie-Kulisse und dramatischer Musik gleitet das Kanu des Manitu über den Bildschirm. Die Fortsetzung des Films „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001 spiegelt eine lange Tradition der deutschen Faszination für die Kulturen der indigenen Völker Amerikas wider oder genauer gesagt, für ein Bild, das oft weit entfernt von der historischen Realität ist. Es ist eine bunte, gefällige Welt, die wenig mit der Wirklichkeit der indigenen Völker Nordamerikas zu tun hat. Hinter der Fiktion liegt eine andere Realität, eine Geschichte von Enteignung, Widerstand, kultureller Stärke und dem anhaltenden Kampf um Anerkennung. Die humorvolle Anspielung auf Karl Mays Figuren wie Winnetou illustriert einen Umgang mit indigener Kultur, der zwischen Verklärung, Klischee und einer teils liebevollen, teils problematischen Aneignung oszilliert.
Karl Mays „Edle Wilde“
Karl May prägte das Bild des „edlen Wilden“ wie kaum ein anderer. Seine Abenteuerromane um den Apachenhäuptling Winnetou und seinen Freund Old Shatterhand vermittelten ein Bild von den indigenen Völkern, das tief romantisiert und idealisiert ist. Seine Bücher vermitteln ein Idealbild von Tapferkeit, Ehre und Naturverbundenheit, das sich in der kollektiven Vorstellung festsetzt und eher eine europäische Fantasie über amerikanische Ureinwohner widerspiegelt als deren realen Alltag oder Geschichte. May schrieb seine Geschichten größtenteils aus zweiter Hand und hatte kaum persönliche Erfahrungen mit den realen Indigenen. Seine erste Reise nach Amerika unternahm er erst im Alter von 60 Jahren, was seine literarische Vision jedoch kaum beeinflusste. Diese romantisierte Darstellung wurde durch die nationalsozialistische Propaganda weiter verstärkt. Adolf Hitler und andere führende NS-Funktionäre waren bekannte Bewunderer Karl Mays. Sie sahen in Winnetou und der Idee des „edlen Wilden“ eine Projektion von Idealvorstellungen, die auch für nationalsozialistisches Heldentum missbraucht wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Karl Mays Romane weiterhin gelesen, und die in den 1960er Jahren populären Winnetou-Filme von Regisseur Harald Reinl festigten das Bild des friedliebenden Naturmenschen. Auch wenn die Filme oft die indigene Kultur stark vereinfachten und verfälschten, zeigten sie die Ureinwohner Amerikas überwiegend in einem positiven Licht, als tapfere, gerechte und naturverbundene Menschen, die sich gegen weiße Eindringlinge zur Wehr setzen.
Karl Mays Werke wurden in Deutschland ein kulturelles Phänomen und prägten Generationen. Sie vermittelten nicht nur Abenteuerlust, sondern auch ein Stereotyp, das einherging mit einer verklärten Sicht auf Naturverbundenheit, Tapferkeit und Ehre, oft ohne die realen sozialen, politischen und historischen Kontexte der indigenen Völker zu berücksichtigen. Heute ist das Bild der „Indianer“ in Deutschland tief im kollektiven Bewusstsein verankert und hat sich in vielfältigen Freizeitgruppen, Vereinen und Festivals niedergeschlagen. Diese Idealisierung hat jedoch einen hohen Preis: Sie ignoriert weitestgehend die tatsächliche Geschichte von Kolonialismus, Vertreibung, Zwangsassimilation und Diskriminierung, der die indigenen Völker Amerikas seit Jahrhunderten ausgesetzt sind.
Zwischen romantisierter Filmwelt und harter Realität
Die tatsächliche Lebenswirklichkeit der indigenen Völker Amerikas war und ist von brutaler Kolonialisierung geprägt. Schon ab dem 15. Jahrhundert führte die Ankunft europäischer Siedler zu Landraub, Gewalt und kultureller Zerstörung. Krankheiten wie Pocken und Masern, die von den Europäern eingeschleppt wurden, führten zu einem drastischen Bevölkerungsrückgang. Traditionelle Lebensweisen, territoriale Rechte und kulturelle Strukturen wurden zerstört oder stark beeinträchtigt. In den USA führte den „Indian Removal Act“ im 19. Jahrhundert zu den gewaltsamen Deportationen ganzer Stämme und wurde später bekannt als der „Trail of Tears“. Kanadas First Nations erfuhren ähnlich brutale Maßnahmen, unter anderem durch die Zwangsassimilation in sogenannten „Residential Schools“ oder „Indian Boarding Schools“, die kulturellen Identitäten zu brechen versuchten. Der Spruch “Kill the Indian in him, and save the man” (Töte den Indianer in ihm und rette den Menschen) wurde zu dem bekanntesten Satz um die Assimilationsphilosophie zu beschreiben. Die Rede von Captain Richard Henry Pratt, in der er den Satz verwendete, wurde 1892 auf der National Conference of Charities and Correction in Denver, Colorado, gehalten.
Dieses Erbe wirkt bis heute nach. Viele indigene Gemeinschaften kämpfen mit Armut, schlechter Gesundheitsversorgung, hoher Arbeitslosigkeit und dem Kampf um Landrechte. Gleichzeitig gibt es in den USA und Kanada zahlreiche indigene Gemeinschaften mit eigenem politischen Status, die versuchen, ihre Rechte auf Land, Bildung, Gesundheitsversorgung und Selbstverwaltung durchzusetzen. Es existiert ein starkes Bewusstsein für Selbstbestimmung und Widerstand, sichtbar etwa in Bewegungen wie „Idle No More“ oder dem Kampf gegen umweltschädliche Infrastrukturprojekte auf indigenem Land. Eine wachsende Bewegung der kulturellen Renaissance belebt indigene Sprachen, Kunst, Rituale und Wissen neu.
Aufarbeitung und Perspektiven
Die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und den Folgen für indigene Völker ist in Nordamerika heute ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Die USA und Kanada haben in den letzten Jahrzehnten damit begonnen, ihre Geschichte gegenüber den indigenen Völkern kritisch zu reflektieren. Bildungsprogramme, Entschädigungsleistungen, Wahrheits- und Versöhnungskommissionen und kulturelle Anerkennung sind Schritte in diese Richtung. Allerdings wird die Aufarbeitung oft als unvollständig kritisiert, da strukturelle Benachteiligungen fortbestehen. Auch die aktuelle Politik des Präsidenten der USA Donald Trump zeigt Verschlechterungen für das Leben indigener Gruppen. So hob er zum Beispiels Bidens Order „Reforming Federal Funding and Support for Tribal Nations…“ (Reform der Bundesmittel zur Stärkung der Selbstbestimmung indigener Nationen) auf und setzte die Order 14173 ein, die sich gegen Diversity-, Equity- und Inclusion-Programme (DEI) richtet und somit den Zugang zu Kulturfördermitteln und Programmen auch für indigene Minderheiten erschwert.

Kanada ist im Bereich der Aufarbeitung von kolonialem Unrecht und seiner Auswirkungen aktiver. Die „Truth and Reconciliation Commission“ (Wahrheits- und Versöhnungskommission), die von 2008 bis 2015 sowohl in Kanada, als auch den USA tagte, untersuchte das Residential School System, in dem indigene Kinder systematisch ihrer Kultur beraubt wurden. Der Bericht dieser Kommission hat zu weitreichenden Empfehlungen geführt, die Politik, Gesellschaft und Bildung betreffen und die Heilung und Versöhnung fördern sollen. Auch finanzielle Entschädigungen und öffentliche Entschuldigungen sind Teil dieses Prozesses.
In Europa ist die Auseinandersetzung mit kolonialer Geschichte in Nordamerika oft marginal, obwohl wir historisch wesentlich an kolonialen Prozessen beteiligt waren. Die spezifische Geschichte indigener Völker Nordamerikas wird hier meist nur über Popkultur vermittelt, während die koloniale Vergangenheit Europas in Afrika, Asien und anderen Teilen der Welt stärker im Fokus steht. Die europäische Perspektive auf den amerikanischen Kontinent wird oft von idealisierten Bildern geprägt, während die historische Verantwortung weniger thematisiert wird.
In Deutschland, wo der „Indianer-Kult“ mit Karl May und Hobby-Vereinen populär ist, findet eine verstärkte Debatte über kulturelle Aneignung und respektvolle Darstellung indigener Völker statt. Museen und kulturelle Einrichtungen überarbeiten ihre Ausstellungskonzepte, um koloniale Narrative zu hinterfragen und indigene Stimmen einzubeziehen. Initiativen zur Dekolonisierung von Bildung und Wissenschaft sind zunehmend vertreten. Indigene Aktivist:innen und Communities in Europa, wie die Native American Association of Germany e.V., setzen sich vermehrt für Aufklärung ein und bauen Brücken zu indigenen Gruppen in Nordamerika. Gleichzeitig stoßen Diskussionen über die Darstellung indigener Kulturen in Fasching, Westernfestivals und Medien auf Widerstand, aber auch auf neue Sensibilität. Das Bewusstsein, dass koloniale Erzählungen hinterfragt werden müssen und dass der Respekt vor indigener Kultur mehr als eine Frage von Stil oder Spaß ist, wächst. Es geht um historische Gerechtigkeit, Anerkennung und Dialog. Die Debatte um kulturelle Aneignung ist ein Teil dieses Prozesses, der mehr Empathie und Respekt gegenüber indigenen Kulturen fordert.
Von Buchrücknahmen und Film-Boykotten
„Der junge Häuptling Winnetou“ sorgte 2022 in Deutschland für eine Debatte rund um kulturelle Aneignung und stereotype Darstellungen indigener Völker Nordamerikas. Der Film und die begleitenden Kinderbücher des Ravensburger Verlags wurden scharf kritisiert, weil sie Klischees über „edle Indianer“ reproduzierten, ohne Rücksicht auf die reale Geschichte und die Gewalt, die indigenen Gemeinschaften angetan wurde. Insbesondere wurde bemängelt, dass der Film koloniale Machtverhältnisse ausblendet und eine naive Abenteuergeschichte auf Kosten indigener Realität erzählt. Der Ravensburger Verlag reagierte auf den öffentlichen Druck und zog die Bücher noch vor offizieller Veröffentlichung zurück. Während manche diesen Schritt als überzogen bezeichneten, wiesen andere auf die Notwendigkeit hin, koloniale Erzählmuster kritisch zu hinterfragen, besonders dann, wenn sie Kindern vermittelt werden.
Parallel zu dieser Kritik gewinnt die Stimme indigener Künstler:innen, Autor:innen und Aktivist:innen zunehmend an Gewicht. In den letzten Jahren sind mehr Werke von Native Americans in deutschen Übersetzungen erschienen, die auf ihre eigene Geschichte und aktuelle Herausforderungen aufmerksam machen. Sie schaffen Raum für authentische Erzählungen und konfrontieren das Publikum mit den historischen und gegenwärtigen Realitäten indigener Völker. Indigene Menschen, die nach Deutschland und Europa ziehen, bringen ihre eigene Sicht auf Medien und Kultur mit. Oft nehmen sie eine kritische Haltung zu populären Darstellungen ein und fördern zugleich die Verbreitung authentischer Inhalte in neuen Kontexten. Die transnationale Vernetzung indigener Communities ermöglicht einen Dialog über Kontinente hinweg, der zu einem tieferen Verständnis und zu solidarischem Engagement in der europäischen Medienlandschaft beiträgt.
In der Auseinandersetzung mit der Lebensrealität indigener Völker in Nordamerika bieten zeitgenössische Filme, Serien und literarische Werke eine neue Perspektive. Der Film „Smoke Signals“ (1998), unter der Regie des Cheyenne-Arapaho-Filmemachers Chris Eyre, gilt als Meilenstein. Er war einer der ersten Spielfilme, der vollständig von Native Americans geschrieben, inszeniert und produziert wurde. Er erzählt von zwei jungen Männern aus einem Reservat in Idaho und zeigt, wie moderne indigene Lebenswelten oft zwischen Tradition, familiären Konflikten und gesellschaftlichen Herausforderungen pendeln. Ebenso eindrucksvoll ist „Rhymes for Young Ghouls“ (2013) von Jeff Barnaby (Mi’kmaq), der auf drastische Weise die Traumata aufarbeitet, die durch das kanadische System der „Residential Schools“ entstanden sind. Eden Robinsons Roman „Son of a Trickster“ (2017), auf dem die Serie „Trickster“ (2020) basiert, kombiniert Jugendkultur mit Elementen indigener Erzähltraditionen. Der Essayband „Indigenize the Future“ (2020) zeigt theoretische wie praktische Ansätze auf, wie indigene Perspektiven auf Bildung, Wissenschaft und Ökologie als Wegweiser für eine nachhaltigere Zukunft dienen können.
„Indianer“ und „Cowboys“
Die Faszination für das Leben amerikanischer Ureinwohner hat in Deutschland eine ausgeprägte Subkultur hervorgebracht. Im Europapark eröffnete erst dieses Jahr die Westernstadt Silver Lake City, in der Tipi Zelte neben Western-Blockhütten und Planwagen stehen. Es existieren zahlreiche Vereine, die sich der Darstellung und dem Nachspielen des Lebens amerikanischer Ureinwohner und Cowboys widmen. Besonders in Freiburg gibt es eine dichte Vereinslandschaft mit Namen wie „Sioux West“, „Mescalero Apachen e.V.“, „Cowboy Club Buffalo“, „Wild West Club“ oder „Indian Club Cheyenne“. Die Ursprünge solcher Vereine reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Inspiriert wurden sie von den Karl-May-Romanen, amerikanischen Westernfilmen und teilweise von amerikanischen Siedlern selbst. Diese Vereinigungen organisieren Sommerfeste, Lagerfeuer-Wochenenden und Wettkämpfe, bei denen die Mitglieder in selbst genähter Tracht auftreten, traditionelle Tänze aufführen und indigene oder cowboytypische Fertigkeiten trainieren.
Doch dieses Hobby ist auch mit kritischen Fragen verbunden. Viele Vereine arbeiten mit stereotypischen Symbolen wie Federschmuck, Tipis, Tomahawks, und eine teils vermischte, wenn nicht sogar frei erfundene kulturelle Symbolik aus verschiedenen Stämmen und Regionen Nordamerikas. Die Praxis, verschiedene indigene Kulturen und Symbole aus unterschiedlichen Regionen und Zeiten zu vermischen, führt zu einem verzerrten Bild, das mehr der Sehnsucht nach einem Abenteuer entspricht als der authentischen Kulturvermittlung. Sie wirft Fragen zur kulturellen Aneignung auf, bei denen es nicht nur um Respekt vor den Originalkulturen, sondern auch um das Bewusstsein geht, dass solche Praktiken koloniale Machtverhältnisse reproduzieren können. Der Begriff „Indianer“ selbst, der historisch auf einen Irrtum Christoph Kolumbus‘ zurückgeht, wird von vielen Angehörigen indigener Völker als unzutreffend oder sogar abwertend empfunden. Doch die deutsche „Indianer“-Subkultur verwendet diesen Begriff weiterhin breit, oft ohne kritische Reflexion. Teils wird die Kultur der amerikanischen Ureinwohner zu einer Art „Karnevalskostüm“ umgedeutet, was den tiefen kulturellen und spirituellen Hintergrund ignoriert und die indigene Kultur auf eine exotische Folklore reduziert.
Das Kanu des Manitu
„Das Kanu des Manitu“ ist die Fortsetzung eines Film, der längst Kultstatus erreicht hat. „Der Schuh des Manitu“ (2001) war nicht nur ein komödiantisches Experiment, sondern auch ein Spiegel der popkulturellen Landschaft seiner Zeit. Der Originalfilm parodierte die Karl-May-Verfilmungen der 1960er-Jahre, spielte mit überzogenen Stereotypen und breitem Slapstick-Humor und erreichte damit ein breites Publikum. Dabei war er in seiner eigenen Zeit unterhaltsam, innovativ, ein Spiegel der humoristischen Sehgewohnheiten und zugleich ein Kommentar auf die Darstellung indigener Figuren im deutschen Kino.

Das Sequel hingegen steht vor der Herausforderung, dass die Bedingungen sich radikal verändert haben. Humor, der einst als subversiv und pointiert galt, wirkt heute veraltet, problematisch und oberflächlich. Die neuen Zuschauer:innen kommen aus einem kulturellen Kontext, in dem Diskussionen um kulturelle Aneignung, Repräsentation und historische Sensibilität allgegenwärtig sind. „Das Kanu des Manitu“ versucht, an die Energie des Originals anzuknüpfen, wirkt dabei aber zunehmend wie ein Archivstück, das bekannte Gags und Charaktere in ein modernes Setting transplantiert, ohne die sozialen und politischen Implikationen kritisch zu hinterfragen.
Die Figuren Abahachi und sein Zwillingsbruder, die weiterhin als Helden indigener Kulturen inszeniert werden, sind in dem Film letztendlich selbst keine Angehörigen dieser Völker. Humoristische Momente wie Abahachis wiederholtes „sangs bitte ned Indianer“ oder Santa Maria, der im Winnetou-Buch „Der Ölprinz“ schmökert, setzen lediglich kleine Anspielungen auf das Thema kulturelle Aneignung. Sie bleiben jedoch oberflächlich und verdeutlichen gleichzeitig, dass es nur ein Wink in die Richtung der Beschäftigung mit kultureller Aneignung ist, sich jedoch nicht tiefgehend damit auseinandergesetzt wird. Herbig inszeniert sich am Ende selbst als Vermittler, indem er mit fiktiven Vertreter:innen indigener Völker spricht und sich Absolution erteilt. Auch wenn er kein Mitglied der dargestellten Gemeinschaft ist, wird ihm gesagt, dass er dennoch ihr Häuptling sei – „ein wahrer Apache ist man mit dem Herzen“. Dieser symbolische Akt mag gut gemeint sein, ersetzt aber keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Thematik. Statt Reflexion oder kritischer Neubewertung werden traditionelle Narrative durch einen symbolischen Akt der Absolution überdeckt.
Die filmische Umsetzung bleibt an der Oberfläche: Der Humor lebt von Nostalgie, während eine zeitgemäße narrative Tiefe und kritische Reflexion fehlen. Ein wiederkehrendes Muster von Sketch zu Sketch ersetzt die Entwicklung einer kohärenten Handlung, und selbst der eigens komponierte Soundtrack von Stefan Raab wirkt eher wie eine Reminiszenz an die frühen 2000er als eine musikalische Verankerung in der Gegenwart, was den Eindruck verstärkt, dass der Film in der Vergangenheit feststeckt. So wird aus dem einst innovativen Konzept der Parodie ein Ritual der Selbstbestätigung, ein Augenzwinkern an das Publikum, das sich an das Original erinnert, aber zugleich die kritischen Fragen ausblendet, die heutige Betrachtungen unvermeidlich machen.
Bild: herbX film/ Constantin Film